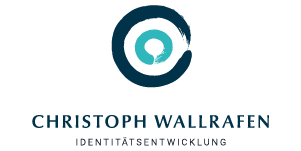„Es gibt doch in der Welt nichts Interessanteres für den Menschen, als wieder der Mensch“ – das schrieb der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt 1822 in einem Brief an eine Freundin. Die Brüder Lumière, die als Begründer des Kinos gelten, waren da noch nicht einmal geboren. Trotzdem bringt Humboldt gut auf den Punkt, warum uns manche Filme noch lange nach dem Abspann bewegen und manche nicht.
Tolle Spezialeffekte, atemberaubende Stunts und imposante Kamerafahrten sind kein Ersatz für eine Geschichte, die uns berührt. Die aber steht und fällt mit Figuren, mit denen wir mitfiebern und mitleiden können – der in Verrissen großer Blocker wahrscheinlich am häufigsten genannte Schwachpunkt sind Figuren, die blass erscheinen. Aber was heißt eigentlich „blass“?
Filmfans wollen dynamische Figuren
In der Literaturwissenschaft gibt es den Begriff der statischen und der dynamischen Figur: Während sich die dynamische Figur im Laufe einer Erzählhandlung entwickelt, bleibt die statische stets gleich. Im Extremfall ist sie eindimensional. In solchen Geschichten ist der Held ebenso von Hause bzw. von Natur aus gut, wie sein Widersacher böse ist.
Der Prinz in der strahlenden Rüstung ist der Gute, die Hexe die Böse – Punkt. So weit, so gut, so einfach. Als wir Kinder waren, haben uns solche Figuren gereicht. Haben wir damals je nach einem Grund dafür gefragt, warum Schneewittchens Stiefmutter böse ist? Vielleicht, aber die Antwort sind uns die Gebrüder Grimm in ihren „Hausmärchen“ schuldig geblieben.
„Es gibt doch in der Welt nichts Interessanteres für den Menschen, als wieder der Mensch.“
Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835), preußischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann
Interessanterweise gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende Zahl von Filmen, die sich genau solcher Fragen annehmen. Und die Antworten geben, weil sie Figuren eine (Vor-)Geschichte geben. Man könnte auch sagen: Weil sie aus ursprünglich statischen Figuren dynamische machen.
Dass solche sogenannten Prequels Konjunktur haben, hat einerseits natürlich eine wirtschaftliche Dimension. Man muss das Publikum nicht erst mit neuen, unbekannten Figuren bekanntmachen (immer ein Risiko), sondern bedient sich eines vorhandenen, bestens eingeführten Inventars. Im Idealfall darf man auf die Treue einer Fanbase zählen, die dem Prequel (der Vorgeschichte), Sequel (der Fortsetzung) oder dem Reboot (alles auf Anfang: Hier wird einfach so getan, als sei die neue Version einer bekannten Geschichte die allererste) bereits mit Spannung entgegensieht.
Hinter Prequels steckt mehr als nur finanzielles Kalkül
Buchhalter freut ein solches Kalkül, mindert es doch das Risiko eines Flops. Und doch steckt mehr dahinter: Fänden Filme, die erklären, wie Stiefmutter („Snow White and the Huntsman“), leiblicher Vater („Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“), Patin („Maleficent – Die dunkle Fee“) oder Halbbruder („James Bond – SPECTRE“) zu dem wurden, was sie sind – kein Publikum – Hollywood ließe sicher die Finger von solchen Stoffen.
Ob im Kino oder im wahren Leben: Dass ein Mensch zwangsläufig böse ist, weil er etwa unter einem guten oder bösen Stern geboren worden ist, wie man etwa in England zu Zeiten Shakespeares gern glaubte, ist für uns keine befriedigende, glaubwürdige Antwort. Das gilt auch fürs umgekehrte Vorzeichen: Helden mit blütenweißer Weste misstrauen wir womöglich noch mehr als rabenschwarzen, durch und durch bösen Bösewichten. Dazu kennen wir uns selbst einfach zu gut.
Wir wissen, dass es schwerer ist, das zu tun, was den Helden zum Helden macht, als es zu lassen. Frei nach Humorist Karl Valentin: Heldentum ist schön, macht aber viel Arbeit. Held ist man nicht, Held wird man. Laut Mythenforscher Joseph Campbell (1904 – 1987) hat die Heldenreise, auf welcher der Held erst zum Helden wird, 18 prototypische Stationen; und zwischen dem Anfang („Berufung“) und Ende („Freiheit zum Leben“) haben auch Weigerung und Zögern ihren selbstverständlichen Platz.
„Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun.“
Edmund Burke (1729 – 1797), irisch-englischer Staatsmann und romantischer Denker
Kein Yin ohne Yang, kein Weiß ohne dunklen Punkt: Der Makel und das Unvollkommene sind Teil des Menschseins. Helden, denen dieser wesentliche Teil an Menschlichkeit fehlt, sind für uns in all ihrer Perfektion keine perfekten Identifikationsfiguren. Der „Super-Man“, den Jerry Siegel und Joe Shuster sich ausgedacht haben, ist, nomen est omen, mehr als ein Mensch – er ist ein Übermensch mit übermenschlichen, phantastischen Kräften und einem geradezu obsessiv wirkenden Hang zum Guten.
Ist es Zufall, dass diesem ersten Superhelden der Comicgeschichte schon bald Konkurrenz erwuchs, die deutlich „geerdeter“ wirkt? Bob Kanes „Batman“, der kurz nach Superman die Bildfläche betrat, ist in den Augen vieler Fans von jeher die interessantere der beiden Figuren gewesen. Immerhin das haben „der Stählerne“ und „der dunkle Ritter“ gemeinsam: Beide haben nicht nur eine Identität, sondern außerdem eine Geheimidentität.
Warum Batman interessanter ist als Superman
Der Superman ist im wahren Leben ein unscheinbarer Reporter, der Batman Unternehmer und Erbe eines schier unerschöpflichen Familienvermögens. Aber während der Superman quasi die Fortsetzung des braven Clark Kent mit anderen Mitteln ist, fällt der Batman deutlich ambivalenter aus – angefangen bei der Maskierung und Farbsymbolik bis hin zu den Schusswaffen, welche die Figur in den ersten Folgen der Comicserie noch tragen darf.
Düster ist auch die Vorgeschichte des Fledermausmanns: Nachdem er als Junge mitansehen musste, wie seine Eltern von einem Straßenräuber erschossen wurden, legt er an dessen Grab den Schwur ab, seine Heimatstadt vom Verbrechen zu säubern. Die Vorgeschichte erklärt einerseits, warum der schwarze Ritter bei der Umsetzung seines Vorhabens nicht gerade zimperlich vorgeht. Andererseits macht sie den Batman zur interessanteren Identifikationsfigur.
Bei Tag der gesellschaftlich angesehene, erfolgreiche Unternehmer, bei Nacht der Maskierte, der Rache – oder um es mit einem neutraleren Begriff zu sagen Vergeltung – für in der Kindheit erlittenes Unrecht übt. Der Batman hat eine Motivation, der Superman nur eine Prädisposition. Anders gesagt: Der Batman ist eindeutig die dynamischere der beiden Figuren. Und wenn die Helden sind, dann ist Batman von beiden fraglos der modernere.
“All I am is what I’m going after.“
Al Pacino in „Heat“, USA, 1995
Als Superman und Batman das Licht der Welt erblicken, sind im Kino die Demarkationslinien zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Helden und Schurken, noch sehr sauber abgesteckt. Das ändert sich in der Folge: Der Film Noir, der seine Hochzeit zwischen 1940 und 1950 hatte, lässt die Grenzen verschwimmen. Die ursprüngliche Trennschärfe findet sich heute nur noch in der Komödie oder in Heldengeschichten, deren Figuren unfreiwillig komisch wirken.
Hollywoods „Schwarze Serie“ wirkt nach und beschert uns immer wieder sehenswerte Filme, die ihren Reiz nicht zuletzt daraus beziehen, dass die Identität der Hauptfigur bzw. Hauptfiguren gewissermaßen auf Messers Schneide steht. In Michael Manns breit angelegtem Gangsterdrama „Heat“ etwa, legt das Drehbuch Cop Vincent Hanna (Al Pacino) im letzten Drittel des Films einen verräterischen Satz in den Mund: “All I am is what I’m going after“. Bekenntnis eines Workaholics – oder klingt darin auch die Ahnung an, dass sich Jäger und Gejagter ähnlicher geworden sind, als zunächst gedacht?
Wer oder was bin ich?
Bei einer statischen Figur stellt sich die Frage nicht, und schon gar nicht wird sie sich diese Frage selbst stellen. In Ridley Scotts stilbildendem, in einer nicht mehr allzu fernen Zukunft spielenden Film Noir „Blade Runner“ hingegen, dreht sich alles um genau diese Frage: „How can ‚it‘ not know what ‚it‘ is?“, fragt Harrison Ford als abgeklärt wirkender Kopfgeldjäger wider Willen in einer Schlüsselszene des Films. „Es“ – das ist in diesem Fall ein sogenannter „Replikant“, ein künstliches, von Menschenhand erschaffenes Wesen, das in seinem Äußeren wie in seinen Reaktionen nicht von denen zu unterscheiden ist, die es erschaffen haben.
Der wesentliche Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf: die eigenen Erinnerungen, über die der eine tatsächlich verfügt und das andere nur vermeintlich. Die eigene Identität als Summe eigener Erfahrungen wird zum kennzeichnenden Wesensmerkmal des Menschen, das ihn vom Geschöpf mit nur vermeintlich selbst durchlaufenem Werdegang abhebt, ihn über es erhebt.
In den letzten Minuten des Films jedoch zerbirst selbst diese vermeintliche Sicherheit: “I’ve seen things you people wouldn’t believe“ (die deutsche Fassung übersetzt “people“, eine Spur zu eindeutig vielleicht, als „Menschen“) – bei dem, was Replikant Roy Batty kurz vor seinem Ende Revue passieren lässt, handelt es sich wahrscheinlich eben doch um ganz eigene Erinnerungen. Wer ist Mensch, wer Maschine? Der Film lässt die Antworten zu, die der Zuschauer selbst findet.
„Ihr seid alle verschieden!“ „Ich nicht!“
aus: Das Leben des Brian, UK, 1979
Eines ist „Blade Runner“ in jedem Fall: ein Film, der inzwischen bereits mehrere Generationen von Kinozuschauern in seinen Bann gezogen hat – und das, obwohl er im Jahr seiner Leinwandpremiere zunächst ein Flop war. Zum gefeierten, richtungsweisenden Streifen hat er sich erst in der Zweitverwertung gemausert. Es musste sich erst herumsprechen, wie sehenswert Ridley Scotts Film ist, der auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick basiert; ein Schicksal, das „Blade Runner“ mit vielen Filmen teilt, die heutzutage gern als Kultfilme bezeichnet werden.
Nicht in allen von ihnen mag die Beschäftigung mit der eigenen Identität so deutlich zutage treten wie in „Blade Runner“. Aber vermutlich haben Stoffe, die sich mit dem Wesen des Menschen beschäftigen, eher das Zeug zum Publikumsliebling als manches überzeugend getrickste, dabei leider aber oft seelenlose „eye candy“. „Blade Runner“ verbindet beides: Optische Effekte, die erstaunlich gut gealtert sind, und eine Handlung, die nicht nur dem Auge etwas bietet, sondern auch dem Rest des Kopfes.
Regisseur Scott ist übrigens durchaus klar, welchen Anteil am langfristigen Erfolg des Films insbesondere Designer und andere bildende Künstler hatten, die den Film entweder bereits im Kino für sich entdeckt hatten oder als er auf Videokassette und später auch auf DVD erschien. Und die sich in der Folge von „Blade Runner“ inspirieren ließen – vom Werbespot für französischen Wodka, der Anleihen bei der in Blade Runner gezeigten Technik (Smirnoff, „Zoom in – track out“) machte bis hin zum LP-Cover und Bühnenbild der britischen Heavy Metal-Band Iron Maiden („Somewhere in time“).
Komplexe Charaktere prägen ganze Subkulturen
Man könnte auch sagen: „Blade Runner“ ist nicht nur einzelnen Zuschauern im Gedächtnis haften geblieben, sondern auch im kollektiven Gedächtnis gesellschaftlich relevanter Subkulturen. Wenn das der Fall ist, entfaltet ein Film auch identitätsstiftende Wirkung: Die, die ihn kennen, erkennen visuelle Anspielungen und nutzen Zitate oder auch Parodien darauf im Sinne kultureller Codes.
„Jeder nur ein Kreuz!“, „Es kann nur einen geben“, „Möge die Macht mit dir sein“, „Ich habe ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann“. Bestimmte Filme zu kennen, zu mögen und zitieren zu können ist nicht zuletzt wesentlicher Bestandteil der Geek Culture, die inzwischen eigene, speziell auf die kulturellen Interessen ihrer Nutzer abgestimmte soziale Netzwerke hervorgebracht hat: Sage mir, welche Filme und Serien du magst, und ich zeige dir andere, die so sind wie du.
Und was ist mit denjenigen, die mit solchen Zitaten nichts anfangen können? Müssen leider draußen bleiben – oder eben Versäumtes nachholen, wenn sie dazugehören möchten.